Ausstellung: „Themenraum Kolonialismus“ im Stadtmuseum Münster
22.08.2025 bis 12.02.2026, Münster
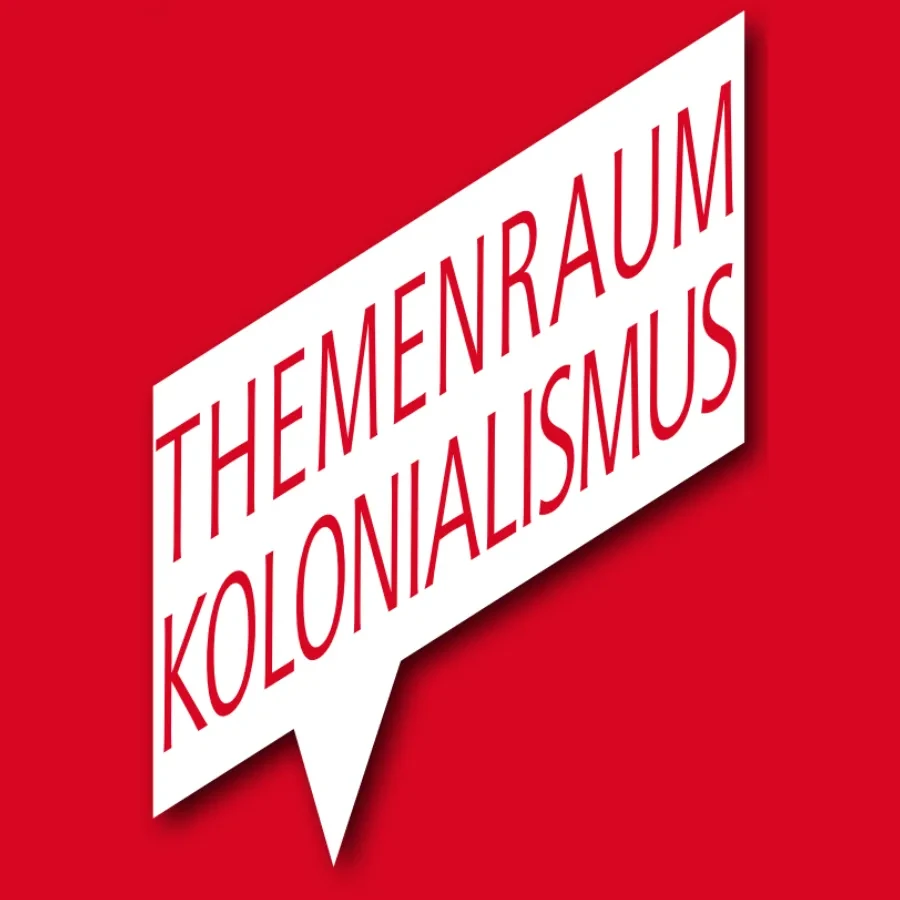
Mitte August 2025 eröffnet im Sonderausstellungsbereich des Stadtmuseums Münster der „Themenraum Kolonialismus“.
Das Ausstellungs- und Dialogprojekt, kuratiert von Prof. Dr. Sarah Albiez-Wieck (Professur für außereuropäische Geschichte an der Universität Münster), Dr. Johannes Jansen (Koordinator im Verbundprojekt „Kolonialgeschichte, Geschichtskultur und historisch-politische Bildung“) und Dr. Barbara Romme (Direktorin des Stadtmuseums Münster), wird erstens in Objektpräsentationen den „Blick auf Kolonialismus“ in Münster im historisch-diachronen Verlauf nachzeichnen. Die Objektauswahl sowie die Abfassung der Objekt- und Tafeltexte erfolgen seit 2023 in Zusammenarbeit mit Geschichtsstudierenden der Universität Münster. Zweitens werden Befunde einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zu Einstellungen zur deutschen Kolonialzeit gemeinsam mit Stimmen hierzu aus der Münsteraner Stadtgesellschaft präsentiert. Drittens werden im Dialograum lokale und regionale zivilgesellschaftliche Akteur*innen und Projekte zum Thema Kolonialismus präsentiert. Zudem befindet sich im Dialograum eine ‚kleine Bibliothek‘, ein Kunstprojekt sowie ein Empowerment-Bereich.









